
Warum ich von Propaganda spreche
MICHAEL MEYEN, 7. August 2021, 5 Kommentare, PDFDieses Buch sollte ursprünglich Die Medien-Matrix heißen. Rubikon-Herausgeber Jens Wernicke war schnell einverstanden, als wir im Oktober 2020 am Rheinufer in Mainz über das Projekt gesprochen haben. Chomsky heiratet Foucault heiratet Bourdieu: Es schien, als würde er das am liebsten gleich selbst schreiben wollen. Ich bin beschwingt durch den Regen in eine Kneipe am Markt marschiert und habe den Anruf überhört. Auf der Mailbox sagte Wernicke: Wir machen das, aber unter einem anderen Titel. Die Propaganda-Matrix. Sonst verkauft sich das nicht. Ich habe mich noch ein bisschen gewehrt, via SMS. Der Akku war fast leer. Lass uns die Propaganda doch in den Untertitel packen oder so. Nicht ganz so offensichtlich. Das Ergebnis der Diskussion steht auf dem Cover.
Der Begriff Propaganda ist in der Matrix des Westens systematisch verdreht worden. Propaganda: Das ist das, was die anderen machen. Nazis und Kommunisten vorzugsweise, aber auch sonst alle Gegner und Feinde. Das Kopfkino hat die Bilder schnell parat. Männer mit wilden Bärten, die in Videos mit Mord und Totschlag drohen und manchmal gleich noch zeigen, was genau sie damit meinen. Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast. Wollt ihr den totalen Krieg?
Propaganda: Das ist der Anfang vom Ende. Das ist Lüge plus Emotion. Das ist Komplexitätsreduktion plus Wiederholung. Die immergleiche Botschaft so oft und so laut, bis auch der letzte Hurra schreit und dabei ignoriert, verdrängt, vergisst, dass dieser Ruf das Leben kosten kann. Wenn heute über solche Bilder gesprochen wird, dann geht es oft gar nicht mehr um den Inhalt, sondern eher um die Technik. Ist dieses Video echt? Wie hat der Goebbels das bloß geschafft? Und es geht um die Wirkung. Wobei: Dass Propaganda wirkt, muss man eigentlich gar nicht diskutieren. Der allgemeine Sprachgebrauch setzt das voraus. (1)
Zusammen mit meiner Kollegin Anke Fiedler habe ich deshalb vor einigen Jahren versucht, Medienlenkung in der DDR als ›politische PR‹ zu verstehen. Wir dachten: Weg mit Lenins Presseformel. Wer in den Schubladen kollektiver Propagandist, kollektiver Agitator und kollektiver Organisator denkt, der sieht nicht mehr, dass die herrschende Partei permanent mit dem Westfernsehen zu kämpfen hatte und ihre Öffentlichkeitsarbeit sowohl an die Zielgruppen anpassen musste (Jugend, Christen, Funktionäre) als auch an die Tagespolitik.
Wenn Erich Honecker Österreich besuchen wollte, die Bundesrepublik oder sogar die USA, wurde der Holzhammer weggelegt, wenigstens für eine gewisse Zeit. Günter Böhme, der ab 1967 für das Neue Deutschland in Bonn war und dann nach dem Abschluss des Grundlagenvertrags mit der Bundesrepublik in der Berliner Redaktion die Abteilung Außenpolitik leitete, hat uns berichtet, wie die SED ihre Presse als »Hilfsmittel« für diplomatische Ziele nutzte: »Das war kurios, vor allem in der Anerkennungsphase. Wer die DDR anerkannte, sollte absolut positiv dargestellt werden. Selbst die finstersten Länder. Sie lachen, aber selbst die Redakteure haben gesagt: Solchen Scheiß soll ich schreiben?« (2)
Ich erzähle diese Geschichte, um meine Reaktion auf den Vorschlag von Jens Wernicke zu erklären. Der Propaganda-Begriff, darauf haben Anke Fiedler und ich uns damals schnell geeinigt, ist erstens nur schwer von Public Relations, Werbung oder Bildung abzugrenzen und zweitens so negativ besetzt, dass er das Ergebnis vor die Analyse setzt. Einseitig, nicht legitim und offenbar selbst dann effektiv, wenn man einräumt, dass sich die Menschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen können und allen Nachrichten aus dem Mund der Partei misstrauen. (3)
Carl Friedrich und Zbigniew Brzezinski zum Beispiel, zwei Harvard-Forscher, die die US-Politik prägten (der eine im heißen und der andere im kalten Krieg), waren sich Mitte der 1950er Jahre auch ohne jeden empirischen Beweis sicher, dass der Dauerbeschuss mit Parolen so oder so zu einer Hirnwäsche führt und bestimmte Stereotypen, Images und Werte in das Denken einsickern lässt. (4) Vielleicht wird mein Unbehagen noch verständlicher, wenn man weiß, dass ich in der DDR Journalist werden wollte. (5) Durch die Totalitarismus-Brille auf mein früheres Selbst zu schauen, wäre mir wie ein später Verrat vorgekommen.
Heute weiß ich, dass ich selbst Opfer einer Hirnwäsche geworden bin. Die akademische Disziplin, die ich an der Universität vertrete, hat vergessen, dass sie als Propagandaforschung geboren wurde, und sich lauter unscheinbare Mäntelchen umgehängt. Publizistik. Kommunikationswissenschaft. Journalistik. Medienforschung. Dabei machen wir nichts anderes als unsere Vorfahren, die im Auftrag von Regierung, Militär und Geheimdiensten in den USA herausfinden sollten und wollten, wie man in die Köpfe der Menschen kommt. Psychologische Kriegsführung.
Kampf um die öffentliche Meinung
Der Leipziger Carl Friedrich, der in den USA erst zum Europa- und dann zum Totalitarismusexperten wurde, war dabei. Staat und milliardenschwere industrienahe Stiftungen (Rockefeller, Ford) haben ab 1939 hunderte Sozialwissenschaftler bezahlt, um auch den Kampf um die öffentliche Meinung zu gewinnen. (6) Ein Ergebnis: Man sprach fortan von Kommunikation und nicht mehr von Propaganda. Das änderte zwar nicht das, wonach man suchte, erlaubte aber, die eigenen ›guten‹ Absichten von den ›schlechten‹ der Deutschen und später der Sowjets abzugrenzen.
Es gibt in meiner Disziplin einen kanonischen Aufsatz, geschrieben 1948 von Paul Lazarsfeld und Robert Merton, zwei Gallionsfiguren der empirischen Sozialforschung. (7) Google Scholar weist für diesen Text im Januar 2021 knapp 2000 Zitationen aus. Zum Vergleich: Meine erfolgreichsten Beiträge liegen hier im unteren dreistelligen Bereich. Lazarsfeld und Merton geht das Wort Propaganda kurz nach dem Kriegsende leicht über die Lippen. 35-mal auf gut 20 Seiten. Sie sprechen über Nachrichtenmedien und kapitalistische Hegemonie sowie über den Link zwischen organisierter Wirtschaft und Massenmedien. Propaganda, da lassen die beiden Klassiker keinen Zweifel, hält das System zusammen. Eine neue Form der Kontrolle, die auch in liberalen Demokratien verhindert, dass gesellschaftliche Strukturen öffentlich hinterfragt werden – vor allem Eigentumsstrukturen.
Obwohl der Aufsatz in vielen Lehrbüchern steht und lange Stoff für Einführungsvorlesungen war, ist dieser Teil des Textes aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Mehr noch: Dass der Journalismus hier und heute irgendetwas mit der Propaganda von gestern zu tun haben könnte, wird rundweg abgestritten. (8)
Wie immer in solchen Fällen funktioniert das, weil wir uns täuschen lassen wollen und weil uns die Matrix, in der wir leben, dafür tausend gute Gründe liefert. Propaganda, so sagt man uns, will das Denken verändern. Propaganda braucht einen Mastermind – Menschen, die wissen, was sie wollen, und entsprechende Pläne machen. ›Wahrheit‹, ›Fakten‹ und ›Vielfalt‹ bleiben dabei auf der Strecke. Und weil diese Übeltäter vor nichts zurückschrecken, ist das Publikum ein leichtes Opfer.
Journalismus und Propaganda?
Das alles passt so gar nicht zu uns und unserer Welt. Wir und wehrlos? Wozu haben wir Schulen und Universitäten besucht und das Abwägen von Für und Wider trainiert? Der Journalismus und Propaganda? Fast jeder von uns kennt jemanden, der in einer Redaktion arbeitet. Umkrempeln wollen uns diese Leute ganz bestimmt nicht. Und selbst wenn sie es wollten, könnten wir einfach umschalten und eine Gegenstimme hören. Vielfalt und Ausgewogenheit, so können wir uns beruhigen, liegt gewissermaßen in der Natur dieses Berufs. Warum sollten wir Rundfunkbeiträge bezahlen (müssen), wenn wir dafür nicht wenigstens den Versuch bekommen würden, ›kritisch‹, ›objektiv‹ und ›ausgewogen‹ zu sein oder aber, wenn dieser Versuch doch einmal misslingen sollte, ein mahnendes Wort aus der Medienforschung, das an die Normen des Berufs und die Kriterien für guten Journalismus erinnert?
Das lateinische propagare ist ein aggressives Wort. Fortpflanzen, vermehren, ausdehnen, erweitern. Die Aura des Substantivs hat die katholische Kirche geprägt, über die Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ein Amt, das den ›richtigen‹ Glauben in die Welt tragen sollte, gegründet 1622 und umbenannt erst 1967, als im Westen niemand mehr ruhig schlafen konnte, der offen zugab, Propaganda zu betreiben, selbst dann nicht, wenn er sich als Stellvertreter Gottes auf Erden ausgeben darf.
Zwischen den beiden großen Kriegen stand dieses Image für einen Moment auf der Kippe. Einerseits hatte man nicht vergessen, was die Regierungen ab 1914 alles getan hatten, um die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. In den Goldenen Zwanzigern wimmelte es außerdem plötzlich von Werbeleuten, die sich selbst Propagandisten nannten und so eher unfreiwillig dafür sorgten, dass ›Propaganda‹ in manchen Kreisen zu einem Schimpfwort wurde. (9) Andererseits aber stammt aus genau dieser Zeit (aus dem Jahr 1928) der wichtigste Versuch, den Begriff zu retten – das Buch Propaganda von Edward Bernays, das bis heute eine wichtige Referenz für die PR-Praxis ist (10) und immer wieder als Beleg herangezogen wird, wenn jemand beweisen möchte, dass wir alle betrogen und belogen werden.
Wie Niklas Luhmann packt Edward Bernays die Quintessenz in seinen ersten Absatz:
»Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen Regierungen in unserem Land«.
Bernays begründet das mit der Komplexität der Moderne. Wir sind so viele und wissen außerdem, dass wir gar nicht in der Lage sind, alle Zusammenhänge zu durchschauen. Also »haben wir uns freiwillig darauf geeinigt, dass unsichtbare Gremien sämtliche Daten filtern, uns nur noch die wesentlichen Themen präsentieren und damit die Wahlmöglichkeiten auf ein verdauliches Maß reduzieren«. (11)
Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, weil es in einer Zeit geschrieben wurde, in der der Begriff Propaganda noch nicht verbrannt war und in der Männer wie Edwards Bernays, der keinen Zweifel daran lässt, selbst zu den Strippenziehern zu gehören, offen für ein Gesellschaftsbild werben können, in dem es starke Führer gibt und eine Herde, die gelenkt werden muss, damit sie nicht außer Kontrolle gerät.
Auch Walter Lippmann, der heute als »Vordenker« des »amerikanischen Imperiums« gilt, (12) sagte ganz unbefangen »Propaganda«, als er Anfang der 1920er Jahre über seine Heimat spricht (die USA):
»Eine Gruppe von Menschen, die der Öffentlichkeit den ungehinderten Zugang zu den Ereignissen verwehren kann, arrangiert die Nachrichten, damit sie ihren Zwecken dienen«. (13)
Heute würde man das strategische Kommunikation nennen. Vielleicht auch Soft Power oder Public Diplomacy. Die Deutsche Welle wäre mit dabei, irgendwie. 2021 knapp 400 Millionen Euro vom Bund. So viel Geld gibt es nicht ohne Gegenleistung. Aber die ›normalen‹ Nachrichten? Arrangiert für einen bestimmten Zweck, ausgeheckt womöglich sogar in dunklen Hinterzimmern?
Innere Bilder produzieren
Für Edward Bernays und Walter Lippmann ist das keine Verschwörungstheorie, sondern Realität. Lippmanns Ausgangspunkt: Wir haben keinen direkten Zugang zur »äußeren Welt«, sondern reagieren auf Bilder – auf unsere Vorstellungen von der Welt. Er nennt diese Vorstellungen etwas irreführend »Pseudoumwelt«, denn das, was wir tun, weil wir an die Bilder in unseren Köpfen glauben, hat sehr reale Folgen. Egal. Der Link zum Journalismus ist auch so überdeutlich. Wenn unser Handeln inneren Bildern folgt, liegt die Macht bei denen, die diese Bilder produzieren – vor allem Bilder von den Orten, die wir selbst eher selten sehen. Syrien. Die Ostukraine. Die Lastwagen von Bergamo. Überfüllte Intensivstationen. Gesichter, die auch Monate später noch von Covid-19 gezeichnet sind. Politiker sind bei Lippmann nicht (nur) Täter, sondern oft auch Opfer. Die Bilder sind immer schon da.
Walter Lippmann wusste schon vor einhundert Jahren, dass Nachrichten alles sein mögen, aber auf keinen Fall ein »Spiegel gesellschaftlicher Zustände«. Wer »Nachricht und Wahrheit« für Synonyme halte, so Lippmann, der komme nicht weiter. Die Routine in den Redaktionen, zu der gehört, voneinander abzuschreiben. Der Zwang, »im Leser Gefühle« wachzurufen. Die Abhängigkeit von Informationen und Daten, die »Industrie« und »Regierung« produzieren. Und vor allem (bereits 1922): »die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit«. Lippmann: »Viele der direkten Kanäle zu Nachrichten sind versiegt, und die Informationen für die Öffentlichkeit werden zu allererst von Presseagenten gefiltert«.
Das ist nah an Edward S. Hermann und Noam Chomsky, um die es im nächsten Kapitel gehen wird. Bei Walter Lippmann baut Propaganda Mauern – Mauern »zwischen Öffentlichkeit und Ereignis«. Ohne solche Mauern kann niemand »eine Pseudoumwelt« errichten, »die er für klug oder wünschenswert hält«. (14) Wären wir in Bergamo gewesen, hätten wir gewusst, was es mit den Lastwagen auf sich hatte.
Wenn das Buch Die öffentliche Meinung heute als Gründungsfibel der Medienforschung gefeiert wird, (15) geht es vor allem um den Begriff »Stereotype«. So nennt Walter Lippmann das, was dem »Gebrauch der Vernunft vorausgeht«. Wir sehen nur, was uns die Bilder in unserem Kopf sehen lassen. Russland auf Expansionskurs. Die USA als Hort der Menschenrechte. SARS-CoV-2 als Killervirus. »Nichts verhält sich der Erziehung oder der Kritik gegenüber so unnachgiebig wie die Stereotype. Sie bestimmt die Wertung eines Gegenstands bereits im Moment seiner Wahrnehmung«. Was Walter Lippmann über die Zwischenkriegsjahre schreibt, könnte von heute sein, auch wenn wir eher fahren oder fliegen als zu Fuß zu gehen:
»Um die Welt zu durchwandern, müssen die Menschen Karten von dieser Welt haben. Ihre beständige Schwierigkeit besteht darin, dass sie sich Karten beschaffen müssen, die nicht bereits durch ihre eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse irgendeines anderen verfälscht worden sind«. (16)
Die Angst vor den Massen
Wer mag, kann mit diesem Satz aus Walter Lippmann einen frühen Journalismuskritiker machen. (17) Lippmann kennt schon all das, was Edward S. Herman und Noam Chomsky eines noch sehr fernen Tages in ihr Filtermodell einfügen werden, und weiß außerdem, dass die Leitmedien keine einigermaßen tauglichen Weltkarten liefern können, solange sie Geld einbringen müssen und dem Kapitalismus dienen. Aber Vorsicht. Wie Edward Bernays glaubt auch Walter Lippmann nicht an den Mann auf der Straße oder an die Frau von nebenan. Vielleicht ist LeBon zu frisch, wie überhaupt die Angst vor den Massen und vor all dem Unbewussten, was sich irgendwann entladen könnte. (18)
Walter Lippmann, der im Krieg zum innersten Zirkel um Präsident Wilson gehörte, träumte von einer Regierung der Experten, die sich als Volksherrschaft tarnt. Von einer Gesellschaft, in der Männer wie er die große Herde führen – und zwar »über eine gezielte Beeinflussung der öffentlichen Meinung«. Propaganda. »Gelenkte Demokratie«. (19) Öffentliche Meinung: Das sind bei Walter Lippmann die »Bilder, nach denen ganze Gruppen von Menschen« handeln und vor allem die, die für sich beanspruchen, im Namen solcher Gruppen aufzutreten. (20) Diese Bilder kann man nicht dem Zufall überlassen oder irgendwelchen Redaktionen.
Sein Jünger Edward Bernays hält »Propaganda im eigentlichen Sinne des Wortes« ein paar Jahre später folgerichtig für »eine vollkommen legitime Aktivität«. Ohne »öffentliche Zustimmung«, da ist Bernays ganz modern, »kann kein größeres Vorhaben« mehr gelingen. Seine Propaganda-Definition: »der wohlorganisierte Versuch, einen bestimmten Glauben oder eine Doktrin zu verbreiten«. Drei Seiten weiter wird das noch etwas konkreter:
»Moderne Propaganda ist das stetige, konsequente Bemühen, Ereignisse zu formen oder zu schaffen mit dem Zweck, die Haltung der Öffentlichkeit zu einem Unternehmen, einer Idee oder einer Gruppe zu beeinflussen«. (21)
"Den Volkswillen formen"
Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, Werbung, Marketing: Für Edwards Bernays ist das alles die gleiche Chose. Die Menschen dazu bringen, den Wünschen des Auftraggebers zu folgen: Das ist des Pudels Kern. Die Branche liest ihm nach wie vor aus den Händen, weil er seinen Job als »Wissenschaft« verkauft und suggeriert, dass sich alles erreichen lässt, wenn der »PR-Berater« nur gut (und teuer) genug ist. (22) Eingepreist ist dabei das Wissen über den Journalismus. Wir müssen in die Zeitung, sagt Edward Bernays, in das »Hauptmedium« der Propaganda. Und ich sage euch, wie das geht. Er dient sich so auch gleich den »unsichtbaren Herrschern« an. Was immer ihr vorhabt: Das »Mittel zur Durchsetzung« ist nah. »Ein seriöser und talentierter Politiker ist dank des Instrumentariums der Propaganda in der Lage, den Volkswillen zu formen und zu kanalisieren«. (23)
Das ist PR für die PR, natürlich, und hat doch einen wahren Kern. Der Journalismus ist für Menschen wie Edward Bernays nur ein Mittel zum Zweck. Wer die Logik dieses Feldes kennt, kann es für sich nutzen, vollkommen unabhängig davon, was in den Chefredaktionen behauptet wird. Und: Wer dem Volk misstraut, spricht sonntags von Demokratie und setzt unter der Woche auf Propaganda – hier zunächst verstanden als Sammelbegriff für alles, was »eine bestimmte Haltung oder Meinung herbeiführen soll«.
Andreas Elter, ein deutscher Journalist und Historiker, der sich tief in US-Archive hineingegraben hat, um die Geschichte der »Kriegsverkäufer« von Woodrow Wilson bis zum zweiten Bush schreiben zu können, nennt eine ganze Reihe von »Propagandamitteln«: Presse, Funk und Fernsehen, »Schriften und Flugblattaktionen«, Werbefilme, Großveranstaltungen. Propaganda, darauf kommt es Andreas Elter ganz im Geist von Walter Lippmann und Edward Bernays an, will »immer eine bestimmte, eindeutig gefärbte Sichtweise der Dinge« vermitteln »und damit die öffentliche Diskussion in die gewünschte Richtung« manövrieren. (24)
Das Ideal mit der Wirklichkeit verwechseln
Man könnte folglich sagen: Propaganda ist das Gegenteil von meinem Journalismusideal, das auf den mündigen Bürger setzt und darauf, dass wir in der Lage sind, selbständig zu entscheiden, wenn wir nur alle relevanten Informationen bekommen. Ich habe dieses Ideal mit der Wirklichkeit verwechselt, als ich kurz gezögert habe, ein Buch über Die Propaganda-Matrix zu schreiben. Ein Historiker wie Andreas Elter hat es da etwas leichter, weil er nicht in der Zeitung blättert, sondern in den Akten der Macht. Elter sagt: Propaganda und Zensur gehören zur gleichen Medaille. Auf der einen Seite etwas herbeiführen und auf der anderen etwas unterdrücken.
Elter kennt auch die Gretchenfrage, die verhindert, dass mein Ideal zur Wirklichkeit wird: Was ist wichtiger – eine »freie unabhängige Presse ohne Zensur und Staatspropaganda oder die Wahrung der nationalen Sicherheit«? Während man sich bei der einen Alternative (Pressefreiheit) schnell einig sein dürfte, ist die andere so vage, dass sie der Willkür Tür und Tor öffnet. (25) Spätestens seit dem Frühjahr 2020 wissen wir auch in Deutschland: Regierungen können die »nationale Sicherheit« einfach mit dem eigenen Überleben gleichsetzen oder sogar mit irgendeinem Inzidenzwert. Dann darf auch die Bundeswehr in die Schlacht gegen ein Virus ziehen.
Was Andreas Elter in seinem Buch über die unendlich vielen Kriege der US-Amerikaner beschreibt, würde Jacques Ellul »politische Propaganda« nennen. Das, was einem sofort einfällt, wenn man an Propaganda denkt. Was Regierungen machen, Parteien, Behörden, Lobbygruppen. Was Hitler und Stalin gemacht haben. Das Ziel ist einigermaßen klar, und die Mittel sind es auch. Nachzulesen bei Edward Bernays.
Jacques Ellul, ein Franzose, der in der Résistance war, in Yad Vashem als ›Gerechter unter den Völkern‹ geehrt wurde und sich intensiv mit der Kirche beschäftigte, ist einen Schritt weitergegangen. Politische Propaganda? Gut und schön. Viel wichtiger aber (und viel schwerer zu bemerken), sagt Jacques Ellul, ist die »soziologische Propaganda« – all das, was alle Gesellschaften (China oder die Sowjetunion genauso wie die USA oder Deutschland) nutzen, um möglichst viele Individuen zu integrieren und auch im Ausland attraktiv zu sein. (26)
Jacques Ellul sagt sogar: Gesellschaften brauchen das. Es geht nicht ohne Propaganda. Propaganda ist überall. Der siamesische Zwilling der Moderne. (27) Propaganda liefert einen Lebenssinn sowie Wege, um irgendwie dabei zu sein – genau das, was vorher, vor der Ära der Massengesellschaften, die Kirche, die Familie und die Gemeinschaft vor Ort geliefert haben. Diese »soziologische Propaganda« muss nicht lügen. Sie will auch nicht unbedingt etwas ändern, jedenfalls nicht unsere Meinungen. Und wir können uns auch nur schlecht gegen sie wappnen, jedenfalls nicht über Bildung, weil die »soziologische Propaganda« schon in der Schule einsetzt und an den Universitäten nicht aufhört.
»Soziologische Propaganda« verbreitet ein bestimmtes Set an Lebensstilen und eine Ideologie. (28) »Erfolgreich sozialisierte Gesellschaftsmitglieder« bemerken diese Form der Propaganda überhaupt nicht – auch dann nicht, wenn sie einen Leitartikel schreiben oder einen Spielfilm drehen. (29) Durch die Brille von Jacques Ellul macht es keinen Sinn, Journalisten oder Regisseuren vorzuwerfen, ›von oben‹ gesteuert zu sein, Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern oder sonst irgendwelche bösen Absichten zu hegen. Sie tun das, was sie tun, weil sie es von Kindesbeinen an nicht anders kennengelernt haben.
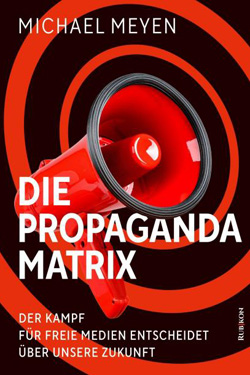
Foucault würde sagen: das »anonyme, zwingende Gedankensystem, das einer Zeit und einer Sprache angehört«. (30) Der Sozialkonstruktivismus sagt: die »institutionelle Ordnung«, in die man hineingeboren wird und die von »symbolischen Sinnwelten« legitimiert wird. Christentum, Sozialismus, Demokratie. Normalerweise lebt der Mensch in so einer »symbolischen Sinnwelt« »ganz naiv« vor sich hin – solange jedenfalls, wie der Alltag funktioniert und bis »eine Gesellschaft auf eine andere stößt, die eine ganz andere Geschichte hat«. (31) Vermutlich kann ich deshalb heute »Propaganda« sagen und damit sowohl die politische Seite meinen als auch die soziologische. Edward Bernays und Jacques Ellul. Meine symbolische Sinnwelt ist 1989/90 untergegangen. Und das, was nach ihr kam, muss mich erst noch überzeugen.
Michael Meyen, "Die Propaganda-Matrix: Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft", Rubikon, 224 Seiten, 18 Euro
Über den Autor: Prof. Dr. Michael Meyen, Jahrgang 1967, studierte an der Sektion Journalistik und hat dann in Leipzig alle akademischen Stationen durchlaufen: Diplom (1992), Promotion (1995), Habilitation (2001). Parallel arbeitete er als Journalist (MDR info, Leipziger Volkszeitung, Freie Presse). Seit 2002 ist Meyen Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienrealitäten, Kommunikations- und Fachgeschichte sowie Journalismus. Er betreibt den Blog Medienrealität.
Anmerkungen
(1) Vgl. Klaus Arnold: Propaganda als ideologische Kommunikation. In: Publizistik 48. Jg. (2003), S. 63- 82
(2) Michael Meyen, Anke Fiedler: Die Grenze im Kopf. Journalisten in der DDR. Berlin: Panama Verlag 2011, S. 121
(3) Vgl. Anke Fiedler, Michael Meyen (Hrsg.): Fiktionen für das Volk: DDR-Zeitungen als PR-Instrument. Münster: Lit 2011, S. 17f.
(4) Vgl. Carl J. Friedrich, Zbigniew K. Brzezinski: Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press 1956
(5) Vgl. Michael Meyen: Das Erbe sind wir. Warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde. Meine Geschichte. Köln: Herbert von Halem 2020
(6) Vgl. Christopher Simpson: Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare, 1945-1960. New York: Open Road 1994, Jeff Pooley: Another Plea for the University Tradition: The Institutional Roots of Intellectual Compromise. In: International Journal of Communication 5. Jg. (2011), S. 1442-1457
(7) Paul F. Lazarsfeld, Robert K. Merton: Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action. In: Lyman Bryson (Hrsg.): The Communication of Ideas. New York: Harper 1948, S. 95-118
(8) Vgl. Florian Zollmann: Bringing Propaganda Back into News Media Studies. In: Critical Sociology 45. Jg. (2019), S. 329-345
(9) Vgl. Mark Crispin Miller: Nachwort. In: Edward Bernays: Propaganda. Die Kunst der Public Relations. 9. Auflage. Berlin: orange-press 2018, S. 137-158, hier 137-141
(10) Vgl. Klaus Kocks: Vorwort. Ebd., S. 11-15, hier 11
(11) Ebd., S. 19f.
(12) So Paul Schreyer in einer Rezension des Lippmann-Buches Die öffentliche Meinung in seinem Blog am 31. Juli 2018.
(13) Walter Lippmann: Die öffentliche Meinung. Wie sie entsteht und manipuliert wird. Herausgegeben von Walter Otto Ötsch und Silja Graupe. Frankfurt am Main: Westend 2018, S. 84
(14) Ebd., S. 84f., 293-303
(15) Vgl. James W. Carey: The Mass Media and Critical Theory: An American View. In: Michael Burgoon (Hrsg.): Communication Yearbook 6. Newbury Park: Sage 1982, S. 18-33
(16) Lippmann: Die öffentliche Meinung, S. 65, 122f.
(17) Vgl. Walter Lippmann: Die Illusion von Wahrheit oder die Erfindung der Fake News. Aus dem Amerikanischen von Karim Akerma. Herausgegeben von Walter Otto Ötsch und Silja Graupe. Frankfurt am Main: Edition Buchkomplizen 2021
(18) Vgl. Gustave LeBon: Psychologie der Massen. Stuttgart: Alfred Kröner 1911, Elias Canetti: Masse und Macht. Hamburg: Classen 1960
(19) Fabian Scheidler: Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Wien: Promedia 2016, S. 165
(20) Lippmann: Die öffentliche Meinung, S. 75 21 Bernays: Propaganda, S. 28f., 31f. 22 Ebd., 40, 50, 128 23 Ebd., S. 27, 83, 127
(24) Andreas Elter: Die Kriegsverkäufer. Geschichte der US-Propaganda 1917-2005. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005, S. 19f.
(25) Ebd., S. 14-17
(26) Jacques Ellul: Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books 1973, S. 62
(27) Vgl. Konrad Kellen: Introduction. Ebd., S. V-VIII, hier V
(28) Ellul: Propaganda, S. 63
(29) Uwe Krüger: Woran erkennt man Propaganda? In: IALANA (Hrsg.): Krieg und Frieden in den Medien. Dähre: Ossietzky 2018, S. 210-215, hier 215
(30) Michel Foucault: Gespräch mit Madeleine Chapsal. In: Daniel Defert, Francois Ewald (Hrsg.): Michel Foucault. Schriften in vier Bänden. Band 1: 1954-1969. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S. 664-670, hier 666
(31) Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 2016, S. 112

Diskussion
5 Kommentare